Insolvenzabhängige Lösungsklauseln – endlich Klarheit?
Schließen zwei Parteien einen Vertrag miteinander und liegt im Laufe der Vertragsbeziehung ein Insolvenzgrund vor oder wird ein Insolvenzantrag gestellt, bzw. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen einer der Vertragsparteien eröffnet, so könnte sich die andere Partei mittels einer „insolvenzabhängigen Lösungsklausel“ von dem Vertrag lösen. Aufgrund einer fehlenden konkreten rechtlichen Grundlage für diese Klauseln ist deren Vereinbarung häufig problematisch. Mit einer solchen Lösungsklausel befasste sich der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom 27. Oktober 2022 (Az. IX ZR 213/21). Konkret ging es hierbei um die Frage, ob diese wirksam vereinbart wurde und welche Wirksamkeitsanforderungen an die insolvenzabhängige Lösungsklausel zu stellen sind.
I. Sachverhalt
Der spätere Insolvenzschuldner betrieb ein Busunternehmen und hatte mit der Beklagten einen Beförderungsvertrag geschlossen, welcher die Beförderung von Schülern beinhaltete. In diesem Beförderungsvertrag wurde der Beklagten das Recht zur fristlosen Kündigung beim Vorliegen eines wichtigen Grundes eingeräumt. Hierunter fassten die Parteien auch einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Nachdem der Kläger die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragte, kündigte die Beklagte den Vertrag mit Hinweis auf die zuvor festgelegte Klausel fristlos. Der Insolvenzverwalter des Schuldners hingegen hielt die Kündigung des Beförderungsvertrags für unwirksam und erhob Klage auf Zahlung der Vergütung bis zum vereinbarten Vertragsende.
II. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Problematisch bei den insolvenzabhängigen Lösungsklauseln ist deren umstrittene Wirksamkeit. Denn hierbei stehen sich die Privatautonomie und die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens gegenüber. Verstärkt wird dieses Problem durch die bisher fehlende abschließende höchstrichterliche Rechtsprechung und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit. Von Seiten des Unternehmens als Insolvenzschuldner spricht besonders der Schutz der Insolvenzmasse sowie der Erhalt der Sanierungschancen des Unternehmens für die Unwirksamkeit einer solchen Klausel. Denn die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sanierung sinkt, wenn mehreren Geschäftspartnern des Insolvenzschuldners erlaubt würde, ihre Verträge mit dem Unternehmen zu kündigen. Zudem wird argumentiert, dass die Unwirksamkeit der insolvenzabhängigen Lösungsklauseln aus dem Wortlaut des § 119 Insolvenzordnung (InsO) folgen würde. Denn bei einem zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von beiden Parteien noch nicht/nicht vollständig erfüllten gegenseitigen Vertrag, hat der Insolvenzverwalter gem. § 103 InsO ein Wahlrecht. Dieser kann entscheiden, ob der Vertrag noch erfüllt werden soll, oder eben nicht. Und gem. § 119 InsO sind Vereinbarungen, welche die Anwendung des § 103 InsO im Voraus ausschließen oder beschränken, grundsätzlich unwirksam. Die Konsequenz wäre, dass die Lösungsklausel, welche das Wahlrecht des Insolvenzverwalters im Voraus ausschließt und den Vertragspartnern des Insolvenzschuldners überlassen würde, unwirksam wäre. Die Gegenauffassung hingegen vertritt die Ansicht, dass die Wirksamkeit der Klauseln bereits aus der Vertragsfreiheit, bzw. der Privatautonomie folge, mindestens jedoch aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes.
Schließlich könnten die Vertragsparteien frei darüber entscheiden, welche Regelungen für den Fall der Insolvenz einer der Parteien getroffen werden sollen. Unabhängig von der Frage der generellen Wirksamkeit der Lösungsklauseln kann das Recht des Insolvenzverwalters unter Umständen jedoch zugunsten eines Insolvenzgläubigers eingeschränkt sein. Beispielsweise, wenn die besonderen Interessen des Vertragspartners deutlich gegenüber den Interessen anderer Insolvenzgläubiger überwiegen.
Das Landgericht wies die Klage ab, das Oberlandesgericht hingegen gab der Klage aufgrund der Berufung des Klägers statt. Daraufhin hob der BGH das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zurück an das Oberlandesgericht. Grund hierfür sei laut BGH, dass die Entstehungsgeschichte des Gesetzes kein hinreichendes Argument für die generelle Unwirksamkeit der Klauseln darstelle. Die InsO hingegen stelle aber auch keinen generellen Grundsatz für die Zulässigkeit eben dieser insolvenzrechtlichen Lösungsklauseln dar. Folglich fehle es hierbei an einer eindeutigen gesetzlichen Grundlage, weshalb die Beschränkung der Vertragsfreiheit nicht ohne eine besondere Rechtfertigung erfolgen könne. Doch wann liegt ein zulässiger Grund zur Beschränkung der Vertragsfreiheit vor? Dieser ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn die Klausel lediglich zur Vereitelung der Ausübung des Verwalterwahlrechts nach § 103 InsO dient. Ob dies der Fall ist, soll anhand des berechtigten Interesses der Vertragsparteien beurteilt werden. Das Gericht stellt bei der Frage, ob ein berechtigtes Interesse an der sofortigen Auflösung des Vertrages im Falle der Insolvenz einer Vertragspartei vorliegt, auf die objektiven Umstände ab. Subjektive Umstände oder Vorstellungen der Vertragsparteien bleiben unberücksichtigt.
III. Konkrete Maßstäbe
Es liegen noch immer keine konkreten Maßstäbe für die Wirksamkeit der insolvenzabhängigen Lösungsklauseln vor. Ob ein berechtigtes Interesse zur Wirksamkeit der Klauseln vorliegt, bleibt weiterhin eine Einzelfallentscheidung und kann nicht pauschal beurteilt werden. Vollkommene Rechtssicherheit schafft das Urteil somit nicht. Jedoch können dem Urteil des BGH Indizien entnommen werden, welche auf die Wirksamkeit der Klauseln schließen lassen. Die Klauseln wären unter anderem dann wirksam vereinbart worden, wenn für die Erbringung der Gegenleistung die Zuverlässigkeit des Schuldners eine wichtige Rolle spielt. Bei Bauaufträgen beispielsweise ist eine insolvenzabhängige Lösungsklausel in der Regel wirksam. Dies wird damit begründet, dass die persönlichen Eigenschaften (wie etwa die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) des Bauunternehmers oder Handwerkers als Auftragnehmer von erheblicher Bedeutung für den Auftraggeber sind. Bei einer Insolvenz ist die Leistungserbringung schließlich nicht mehr hinreichend gewährleistet, weshalb der Auftraggeber nach einem (Eigen)-Insolvenzantrag des Auftragnehmers ein starkes Interesse daran hat, sich frühzeitig von dem Vertrag zu lösen. Hierdurch kann der Auftraggeber den ihm entstandenen Schaden – wie die Mehrkosten, welche durch die anderweitige Vergabe der Restarbeiten entstehen – geltend machen. Das Interesse des Auftraggebers an der frühzeitigen Lösung von dem Vertrag ist überwiegender als das Interesse anderer Insolvenzgläubiger, weshalb die Lösungsklausel bei Bauverträgen rechtmäßig ist. Zudem ist weitestgehend anerkannt, dass Lösungsklauseln zugunsten von Geldleistungsgläubigern unzulässig sind. Grund hierfür ist das mangelnde überwiegende Interesse dieser Gläubiger gegenüber den anderen Gläubigern des Insolvenzschuldners. Wird ein Vertrag zur Beförderung von Schülern geschlossen, so kommt es dem Auftraggeber hauptsächlich auf eine zuverlässige und sichere Beförderung der Schüler an. Laut BGH fehlt die Beurteilung der Tatsacheninstanzen hinsichtlich der Frage, ob dies für ein berechtigtes Interesse der Beklagten ausreicht. Für ein berechtigtes Interesse der Beklagten spricht besonders die Notwendigkeit der Zuverlässigkeit des Vertragspartners für die Sicherstellung einer reibungslosen Beförderung der Schüler. Aber auch die insolvenzbedingte fehlende Absicherung im Falle eines Unfalls sowie die Vermeidung von Leistungsausfällen, welche nach der Stellung eines Insolvenzantrags befürchtet werden können, spielen eine Rolle bei der Beurteilung. Ob sich das Gericht anhand dieser objektiven Umstände für ein berechtigtes Interesse der Beklagten entscheidet, bleibt jedoch abzuwarten.
IV. Treu und Glauben
Wurde die insolvenzabhängige Lösungsklausel wirksam vereinbart, so unterliegt diese laut BGH zusätzlich einer Ausübungskontrolle im Hinblick auf die Einhaltung der Grund-sätze nach Treu und Glauben. Hierdurch würden die schutzwürdigen Belange des Insolvenzschuldners geschützt, falls diese gegenüber der Ausübung des Rechts des Gläubigers überwiegen. Und dadurch könnte verhindert werden, dass Gläubiger, die überhaupt kein schutzwürdiges Interesse an der Lösung des Vertrages haben, von der Klausel Gebrauch machen. Möchte sich beispielsweise ein Gläubiger aufgrund des Eigeninsolvenzantrags des Vertragspartners mittels einer wirksamen Lösungsklausel von dem Vertrag lösen, obwohl die Insolvenz keinerlei Einfluss auf die Durchführung des Vertrages hat und diese auch nicht erschwert würde, so läge hierbei ein Verstoß gegen Treu und Glauben vor. Hieraus folgt, dass selbst die Wirksamkeit der insolvenzabhängigen Lösungsklausel nicht unbedingt Rechtssicherheit für den Insolvenzgläubiger bedeutet. Dieser muss sich vielmehr über die Gegebenheiten des Vertrages und die Interessen der Parteien informieren, um bei der Lösung von dem Vertrag einen möglichen Verstoß gegen die zuvor erläuterten Grundsätze zu vermeiden.
V. Bedeutung für die Praxis
Das Urteil des BGH setzt leider keine eindeutigen Maßstäbe zur Beurteilung der Wirksamkeit von Lösungsklauseln. Vielmehr verdeutlicht es, dass die Interessenlage im Einzelfall entscheidend und eine tiefergehende Prüfung erforderlich ist. Besondere Vorsicht ist hierbei zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geboten, da die objektiven Kriterien zu eben diesem Zeitpunkt den Prüfungsmaßstab für die spätere Beurteilung zur Wirksamkeit der vereinbarten Klausel darstellen. Spätere Interessenlagen sowie subjektive Kriterien werden dabei nicht berücksichtigt. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden und Klarheit über die Wirksamkeit bereits geschlossener Klauseln zu erhalten, sollten die insolvenzabhängigen Lösungsklauseln in jedem Fall geprüft werden. Es ist besonders ratsam, eine solche Prüfung noch vor Vertragsschluss vorzunehmen, da es sich bei diesem Zeitpunkt um den entscheidungserheblichen handelt und besonders hier Fehler gemacht werden, die Jahre später bei Kündigung des Vertrages mit Berufung auf die Lösungsklausel nicht mehr korrigiert werden können.
Wir danken unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Jana Hötel für die tatkräftige Unterstützung zu diesem Beitrag.
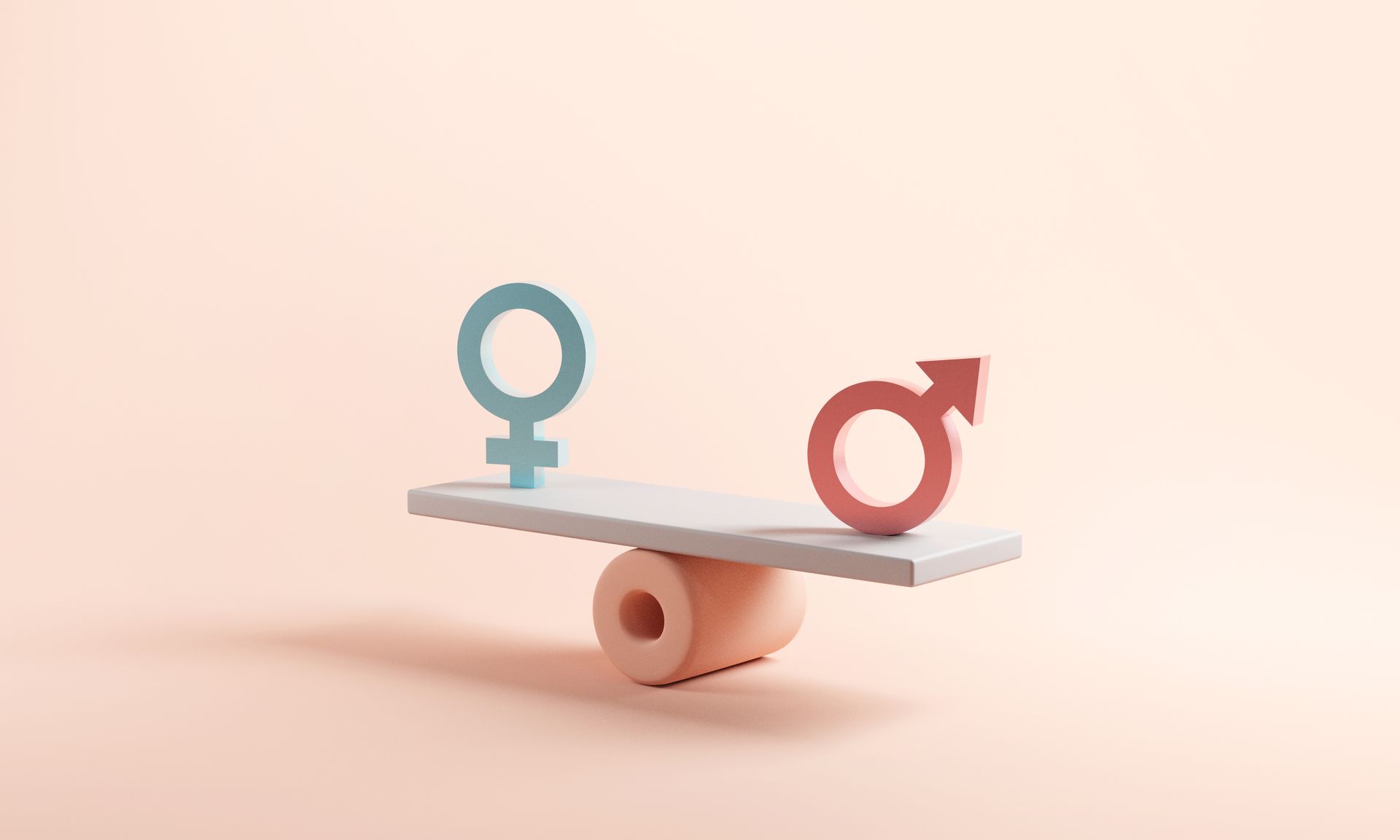
Frauen und Männer haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt – ein Grundsatz, der in seiner Umsetzung viele Detailfragen aufwirft. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat kürzlich zu der prozessualen Dimension von Lohnunterschieden Stellung bezogen. Die aktuelle Entscheidung vom 23.10.2025 lässt den Hinweis auf einen einzigen Kollegen des anderen Geschlechts mit einem höheren Entgelt und gleicher Tätigkeit für einen Anspruch auf höheres Gehalt genügen. Wir zeigen auf, welche praktischen Konsequenzen das Urteil insbesondere für Arbeitgeber hat. I. Das BAG-Urteil vom 23.10.2025 – 8 AZR 300/24 Eine Arbeitnehmerin klagte gegen ihren Arbeitgeber und verlangte eine rückwirkende Anpassung ihres Gehalts für einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren. Nach ihrer Elternzeit stellte sie fest, dass sie im Vergleich zu männlichen Führungskräften derselben Ebene bisher deutlich schlechter bezahlt wurde. Über ein internes Transparenztool des Arbeitgebers erfuhr sie, dass insbesondere ein Kollege der relevanten Vergleichsgruppe eine wesentlich höhere Vergütung als sie selbst erhielt. Die Vorinstanz hielt es nicht für ausreichend, einen einzelnen Arbeitnehmer zum Vergleich heranzuziehen und sprach ihr zunächst lediglich eine Anpassung in Höhe der Differenz der Medianentgelte zwischen weiblicher und männlicher Vergleichsgruppe zu. Das BAG hat diese Auffassung nicht geteilt. Es stellte klar, dass der Vergleich mit einem einzelnen männlichen Kollegen genüge, soweit die Arbeitnehmerin darlege, dass der Arbeitgeber diesem Kollegen eine höhere Vergütung zahle, obwohl er die gleiche oder jedenfalls gleichwertige Arbeit verrichte. Die Größe der Vergleichsgruppe spiele dabei keine Rolle. Die benachteiligte Arbeitnehmerin müsse sich in einem solchen Fall nicht auf den Medianwert beschränken. Bereits der Vergleich mit einem einzelnen Kollegen löse die Vermutung einer geschlechtsbedingten Ungleichbehandlung aus. Könne der Arbeitgeber diese nicht entkräften, schulde er die gleiche Vergütung wie dem zum Vergleich herangezogenen Kollegen. Das BAG stützt sich dabei auf die bereits gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wonach bereits das niedrigere Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit eine Diskriminierungsvermutung begründe. Die Beweislast für objektive Rechtfertigungsgründe liege anschließend beim Arbeitgeber. Der Fall wurde sodann zur erneuten Verhandlung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Der Arbeitgeber erhält damit erneut Gelegenheit, sachliche Gründe für die bestehende Vergütungsdifferenz darzulegen. Ob die Klägerin am Ende obsiegt, lässt sich somit noch nicht sagen. Dennoch hat das Urteil des BAG bereits jetzt erhebliche praktische Auswirkungen für Arbeitgeber. Es reicht künftig aus, dass sich eine Arbeitnehmerin auf einen einzelnen, besser bezahlten männlichen Kollegen beruft und umgekehrt. Arbeitgeber sollten darauf vorbereitet sein, dass einzelne Gehälter als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Folglich ist dringend zu empfehlen, die Zahlung der Höhe nach unterschiedlicher Vergütungen auf sachliche und objektiv nachvollziehbare Gründe zu stützen und diese Entscheidungsgründe zu dokumentieren. Es empfiehlt sich somit, die unternehmensintern bestehenden Vergütungsstrukturen sorgfältig zu überprüfen und sicherzustellen, dass Entgeltentscheidungen geschlechtsneutral getroffen und transparent dokumentiert werden. II. Die aktuelle Rechtslage – Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie Im Zusammenhang mit dieser aktuellen BAG-Entscheidung steht auch die derzeit noch ausstehende Umsetzung der europäischen Entgelttransparenzrichtlinie. Die 2023 verabschiedete EU-Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970 hat zum Ziel, das Gebot der Entgeltgleichheit unionsweit weiter zu stärken. Bis zum 7. Juni 2026 muss sie in nationales Recht umgesetzt werden. Die aktuelle Fassung des deutschen Entgelttransparenzgesetzes enthält bereits heute verschiedene Vorgaben zur Sicherstellung gleicher Bezahlung von Frauen und Männern, die im Wesentlichen auf einem Auskunftsanspruch, freiwilligen betrieblichen Prüfverfahren und Berichtspflichten beruhen. Der bestehende Pflichtenkatalog für Arbeitgeber soll mit der Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie allerdings deutlich erweitert werden. Auch wenn die Umsetzung der Richtlinie noch aussteht, liegt inzwischen bereits der Abschlussbericht der von der Bundesregierung zur Umsetzung in nationales Recht eingesetzten Kommission mit dem Auftrag „bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie“ vor. Im Mittelpunkt stehen dabei Leitfragen zur praktischen Umsetzung der Berichtspflicht (Art. 9 ETRL), zum Auskunftsanspruch (Art. 7 ETRL) sowie zur Unterstützung der Arbeitgeber. Dieser Bericht, der zwar keine Bindungswirkung entfaltet, aber als Orientierung für den Gesetzgeber bei der europarechtskonformen Umsetzung der Richtlinie dient, skizziert bereits jetzt wichtige Vorgaben für Unternehmen. Wie der Abschlussbericht aufzeigt, erwarten Arbeitgeber zukünftig aller Voraussicht nach niedrigere Schwellenwerte, umfassendere Berichts- und Informationspflichten, verschärfte Transparenzvorgaben sowie konkrete Maßnahmepflichten, sobald Entgeltunterschiede festgestellt werden. III. Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der Entgelttransparenz Die Entgelttransparenzrichtlinie verfolgt das Ziel, den Entgeltgleichheitsgrundsatz zu stärken, indem sie für Arbeitgeber verschiedene Transparenzmaßnahmen vorgibt. Konkret sind insbesondere die folgenden Maßnahmen in der Richtlinie vorgesehen: Ein Auskunftsanspruch für Bewerberinnen und Bewerber über das Einstiegsentgelt oder die Gehaltsspanne. Ein Auskunftsanspruch für Beschäftigte über das Vergleichsentgelt von Kolleginnen und Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Eine Berichtspflicht für Arbeitgeber ab 100 Beschäftigten bezüglich vorgegebener Indikatoren zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle („Gender Pay Gap“). Sanktionen bei Nicht-Einhaltung. Die konkrete Ausgestaltung durch den nationalen Gesetzgeber bleibt noch abzuwarten. Die angedachten Maßnahmen verdeutlichen jedoch bereits, dass sich für Unternehmen im kommenden Jahr aller Voraussicht nach einige neue Pflichten ergeben werden, die von dem Nachkommen eines Auskunftsersuchens über Berichtspflichten bis hin zur verpflichtenden Reaktion auf mögliche Entgeltdifferenzen reichen. Der Abschlussbericht liefert bereits einige konkrete Ansätze zur Umsetzung der Maßnahmen: 1. Berichtspflicht: Die Kommission empfiehlt, den Entgeltbegriff zur Wahrnehmung der Berichtspflicht präzise zu definieren. Maßgeblich sei dabei das Ist-Entgelt, also das tatsächlich gezahlte Entgelt inklusive Grundgehalt, Zulagen und regelmäßig gewährter sonstiger Vergütungsbestandteile. Sie schlägt vor, geringwertige Sachleistungen oder vom Arbeitgeber nicht gewährte Aktienoptionen von der Berichtspflicht auszunehmen. Zudem könnte eine Öffnungsklausel eingeführt werden, sodass variable oder ergänzende Entgeltbestandteile entweder als Summe oder in sinnvoll zusammengefassten Gruppen dargestellt werden dürfen, um den Aufwand zu begrenzen. 2. Auskunftsrecht mit anschließendem Abhilfeverfahren: Die Kommission schlägt vor, dass Beschäftigten ein Auskunftsrecht zugesprochen wird hinsichtlich des eigenen Entgelts, des durchschnittlichen Entgelts von Kolleginnen und Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit sowie der maßgeblichen Entgeltkriterien und -bestandteile. Das Auskunftsrecht erfordert demnach eine vorherige Vergleichsgruppenbildung durch den Arbeitgeber. Sollten aus den Auskünften geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede hervorgehen, die nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt sind, ist ein zweistufiges Abhilfeverfahren vorgesehen, welches von Arbeitgebern unter anderem verlangt, einen Pl an mit konkreten Maßnahmen sowie Fristen zur Herstellung der Entgeltgleichheit zu entwickeln. 3. Tarifgebundene und anwendende Unternehmen: Ein weiterer bedeutsamer Punkt des Abschlussberichts der Kommission ist der Umgang mit tarifgebundenen beziehungsweise tarifanwendenden Arbeitgebern. Zwar wurden Sonderprivilegien für diese Arbeitgeber von der Kommission diskutiert, im Ergebnis soll die Anwendbarkeit von Tarifverträgen jedoch nicht automatisch vor dem Vorwurf der Entgeltdiskriminierung schützen. Auch in tariflich geregelten Systemen müssen Entgeltgruppen demnach objektiv und geschlechtsneutral begründet werden. Die Kommission schlägt indes eine Angemessenheitsvermutung im Anwendungsbereich von Tarifverträgen vor. Beim Auskunftsrecht solle das Auskunftsersuchen zunächst auf die tarifliche Entgeltgruppe des Auskunftssuchenden beschränkt sein, eine Korrektur solle nur erforderlich sein, wenn nachgewiesen werde, dass die tarifliche Gruppenbildung nicht den Vorgaben des Art. 4 Abs. 4 ETRL entspreche. Tarifgebundenen und tarifanwendenden Unternehmen sollen dabei gleichbehandelt werden. Auch längere Fristen für Auskunftsersuchen von tarifgebundenen Arbeitgebern werden empfohlen, um Abstimmungen mit Arbeitgeberverbänden zu ermöglichen. IV. Ausblick und Handlungsempfehlung Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie lässt nur begrenzte nationale Gestaltungsspielräume zu. Viele Vorgaben ergeben sich unmittelbar aus dem Richtlinientext, sodass Unternehmen hier nicht auf nationale Spielräume hoffen können. Der Abschlussbericht macht außerdem deutlich, dass trotz der Bemühungen um Bürokratieabbau der Aufwand für Unternehmen nicht ganz entfallen wird. Das nationale Gesetzgebungsverfahren soll konkret Anfang 2026 beginnen. Für Unternehmen besteht bereits jetzt Handlungsbedarf. Unternehmen sind gehalten, bereits jetzt die entsprechenden Daten aufzubereiten und das bestehende Entgeltsystem auf den Prüfstand stellen. Neben dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren verdeutlicht auch die aktuelle Rechtsprechung des BAG, dass Arbeitgeber gut beraten sind, die Entgelttransparenz und Entgeltgleichheit ernst zu nehmen. Die nächsten Monate sollten genutzt werden, um tragfähige Konzepte für die Umsetzung der neuen Anforderungen zu erarbeiten. Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie erfordert ein sorgfältiges Vorgehen, aber bietet zugleich klare Leitplanken, um Transparenz, Rechtssicherheit und Effizienz miteinander zu verbinden. Unternehmen, die frühzeitig aktiv werden, sind gut vorbereitet sowohl im Hinblick auf die gesetzlichen Pflichten als auch auf eine moderne, geschlechtsneutrale Entgeltpolitik. Wenn Sie Unterstützung bei der konkreten Umsetzung benötigen stehen wir Ihnen als rechtlicher Partner gerne zur Seite. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an Ihren Pelka-Berater oder Frau Rechtsanwältin Natalie Lieven. Gerne können Sie auch unser Kontaktformular ausfüllen.

Pelka hat eine in Luxemburg ansässige Aktiengesellschaft („S.A.“) beim grenzüberschreitenden Herein-Formwechsel in eine deutsche GmbH beraten. In Zusammenarbeit mit Berufskolleginnen und -kollegen aus Luxemburg und den zuständigen Gremien der Gesellschaft wurden die erforderlichen Dokumente erstellt, um den Anforderungen der auf der Grundlage der EU-Umwandlungsrichtlinie ergangenen nationalen Gesetzgebung sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland zu genügen und die Eintragung der Gesellschaft ins deutsche Handelsregister nunmehr „als deutsche GmbH“ zu erreichen. Seit der Umsetzung der EU-Umwandlungsrichtlinie in nationales Recht durch das sog. UmRUG (Um-wandlungsrichtlinienumsetzungsgesetz) ist der grenzüberschreitende Formwechsel von Kapitalge-sellschaften innerhalb der EU in Deutschland gesetzlich geregelt. Da es sich auch bei einem grenzüber-schreitenden Formwechsel um eine identitätswahrende Umwandlung handelt, kommt es weder zu Vermögensübertragungen noch zur steuerlichen Aufdeckung von stillen Reserven. Der grenzüberschreitende Herein-Formwechsel ist sowohl bei Notaren als auch beim Handelsregister ist noch keineswegs ein alltäglicher Vorgang, der mit Routine und Erfahrung rasch abgewickelt werden kann. Die Beratung war insbesondere darauf ausgerichtet, die Handelsregistereintragung möglichst zügig und ohne Rückfragen oder gar Zwischenverfügungen seitens des Gerichts zu erlangen. Das Mandat wurde vorwiegend betreut von Stephan Hettler (M&A, Corporate) und Alexander Krämer (Tax).

Die steuerlichen Fragen rund um sogenannte Kryptowerte haben in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, da die Nutzung und Verbreitung von blockchain-basierten Vermögenswerten wie Bitcoin, Ethereum und sonstigen Token sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich stark zugenommen hat. Die Finanzverwaltung hat auf diese Entwicklung reagiert und erstmals am 10. Mai 2022 (BStBl I S. 668) ein umfassendes BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und sonstigen Token veröffentlicht. Mit dem aktuellen BMF-Schreiben vom 6. März 2025 hat die Finanzverwaltung die ertragsteuerliche Behandlung von Kryptowerten nochmals erläutert und insbesondere die Anforderungen an die Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten konkretisiert. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über einige wichtige Punkte, die Sie im Hinblick auf die neuere Finanzverwaltungspraxis beachten sollten. I. Begrifflichkeiten und Einordnung Das BMF verwendet künftig den Begriff „Kryptowerte“ statt wie bisher "virtuelle Währungen und sonstige Token". Nach der Definition des BMF ist ein Kryptowert die digitale Darstellung eines Wertes oder eines Rechts, der bzw. das unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und gespeichert werden kann. Da der technische Aufbau und die technische Entwicklung von Krypowerten vielfältig sind, richtet sich die ertragsteuerliche Beurteilung im Einzelnen nach dem zugrundliegenden Sachverhalt und der konkret ausgestalteten Funktion des Kryptowerts. Die Wirtschaftsgutsqualität von Kryptowerten ist jedenfalls auch nach der neueren BFH-Rechtsprechung unbestritten. Je nach Tätigkeitsart bzw. -umfang können Einkünfte aus Kryptowerten verschiedenen Einkunftsarten zugeordnet werden. Im Hinblick auf die klassischen Veräußerungsgeschäfte von Kryptowerten richtet sich die steuerliche Einordnung danach, ob sich die Kryptowerte im Privat- oder Betriebsvermögen befinden. Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten im Privatvermögen sind als private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr liegt. Die Freigrenze beträgt 1.000 Euro (bis VZ 2023: 600 Euro) pro Jahr. Wird diese überschritten, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Für die Ermittlung der Jahresfrist ist bei einer Anschaffung oder Veräußerung über eine zentrale Handelsplattform auf die dort aufgezeichneten Zeitpunkte abzustellen. Bei einem Direkterwerb oder einer Direktveräußerung ohne Zwischenschaltung von Intermediären, etwa über eine dezentrale Handelsplattform, ist aus Vereinfachungsgründen in der Regel auf die Zeitpunkte abzustellen, die sich aus der Wallet ergeben. Soll für die Frage, ob die Jahresfrist überschritten ist, das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft maßgebend sein, müssen die Steuerpflichtigen den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch geeignete Unterlagen nachweisen. Einkünfte im Zusammenhang mit Kryptowerten können bereits kraft Rechtsform des Steuerpflichtigen – wenn dieser beispielsweise als eine GmbH organisiert ist – als Einkünfte aus Gewerbebetrieb einzustufen sein. Ansonsten hängt die Einordnung als gewerbliche Tätigkeit bzw. die Zuordnung zu einem etwaigen Betriebsvermögen von den allgemeinen steuerlichen Voraussetzungen ab. Neben dem klassischen An- und Verkauf von Kryptowerten gibt es zudem diverse weitere Geschäftsvorfälle, wie etwa Mining, Staking, Lending etc., die einer besonderen steuerlichen Beurteilung bedürfen. II. Mitwirkungspflichten und Aufzeichnungspflichten Das BMF-Schreiben stellt klar, dass Steuerpflichtige verpflichtet sind, sämtliche relevanten Transaktionen mit Kryptowerten lückenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren. Dies umfasst insbesondere: Datum, Art und Umfang jeder Transaktion (Kauf, Verkauf, Tausch, Übertragungen zwischen Wallets, Mining, Staking etc.) Die jeweils beteiligten Kryptowerte und deren Menge Die Gegenleistung (z.B. Euro-Betrag, andere Kryptowerte) Die Wallet-Adressen und ggf. die Handelsplattformen Die Zeitpunkte der Anschaffung und Veräußerung zur Ermittlung der Haltefrist Die jeweiligen Anschaffungs- und Veräußerungskosten (einschließlich Gebühren) Diese Aufzeichnungen sind spätestens mit Abgabe der Steuererklärung vorzuhalten und auf Nachfrage dem Finanzamt vorzulegen. Die Dokumentationspflicht gilt unabhängig davon, ob die Transaktionen über inländische oder ausländische Börsen bzw. Wallets abgewickelt wurden. Werden Kryptowerte über zentrale Handelsplattformen eines ausländischen Betreibers erworben oder veräußert, wird dadurch eine erweiterte Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen begründet, was insbesondere bedeutet, dass diese gegebenenfalls in diesen Fällen den Sachverhalt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaffen haben. Dies umfasst beispielsweise den regelmäßigen und vollständigen Abruf der Transaktionsübersichten zentraler Handelsplattformen. III. Steuerreports und Belegvorlage Zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten können auch sogenannte Steuerreports oder Transaktionsübersichten verwendet und beigefügt werden. Steuerreports werden häufig direkt von den genutzten Handelsplattformen oder mit Hilfe spezialisierter Software generiert. Die Steuerreports sollten zumindest folgende Angaben enthalten: Übersicht aller Transaktionen im Kalenderjahr Salden der Wallets zu den relevanten Stichtagen Nachweis der Zuordnung der einzelnen Transaktionen zu den jeweiligen Wallets Berechnung der steuerpflichtigen Gewinne/Verluste Nutzen Steuerpflichtige Steuerreports, müssen die Einkünfte vollständig und richtig erklärt werden und für die Finanzbehörde nachvollziehbar sein. Einkünfte sind für die Finanzbehörde nachvollziehbar, wenn diese sie anhand vorliegender Unterlagen und Angaben ermitteln und berechnen kann. Die Nachvollziehbarkeit kann im Rahmen der Veranlagung auch über Steuerreports gewährleistet werden, wenn diese bei der Bearbeitung plausibel erscheinen, weil keine Hinweise auf eine Unvollständigkeit vorliegen (z. B. offenkundiges Fehlen einzelner Anschaffungskosten, Wallets oder Handelsplattformen), sie in sich schlüssig sind (z. B. weil Angaben sich nicht widersprechen) und nicht im äußeren Widerspruch zu sonstigen Erkenntnissen der Finanzbehörde stehen. Es ist jedenfalls begrüßenswert, dass Steuerreports, sofern sie denn plausibel sind, im Rahmen der Veranlagung als Belege von der Finanzverwaltung akzeptiert werden. Bei Unsicherheiten oder Zweifelsfragen ist es in jedem Fall ratsam, den Sachverhalt in einem Begleitschreiben zur Steuererklärung ausführlich zu erläutern und sämtliche Belege beizufügen. IV. Fazit Die (ertrag-)steuerliche Behandlung von Kryptowerten ist komplex und erfordert eine sorgfältige Dokumentation sämtlicher Vorgänge. Das aktuelle BMF-Schreiben vom 6. März 2025 stellt hohe Anforderungen an die Mitwirkung und Nachweisführung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Unterlagen und Steuerreports vollständig und nachvollziehbar aufbereiten, um diese bei Anforderung durch die Finanzbehörde einreichen zu können. Für Rückfragen oder Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Unterlagen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können sich hierzu gerne an Ihren Pelka-Berater wenden oder unser Kontaktformular ausfüllen.

Zum Jahresende lohnt sich ein prüfender Blick auf mögliche Steuergestaltungen hinsichtlich etwaiger Vorauszahlungen von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Seit dem Veranlagungszeitraum 2020 dürfen Beiträge für die sogenannte Basisabsicherung bis zum Dreifachen des vertraglich geschuldeten Jahresbeitrags im Voraus gezahlt und im Zahlungsjahr vollständig steuerlich berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden Steueroptimierungsmöglichkeiten sind vielfältig und werden in der Praxis seit Jahren erfolgreich genutzt. Auch mehr als ein Jahrzehnt nach Einführung dieser Regelung hat das Thema nicht an Relevanz verloren. Im Folgenden haben wir daher die wichtigsten Fakten und Praxishinweise kompakt für Sie zusammengestellt: I. Die Einzelheiten der gesetzlichen Regelung im Überblick Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Arbeitslosenversicherung mindern als sog. sonstige Vorsorgeaufwendungen das zu versteuernde Einkommen. Die Beiträge werden dabei nach dem sog. Zufluss-Abfluss-Prinzip berücksichtigt. Das bedeutet, dass sich die Aufwendungen grundsätzlich in dem Jahr steuerlich auswirken, in dem sie tatsächlich gezahlt wurden - unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie tatsächlich bestimmt sind. Dabei ist zwischen zwei Gruppen von Vorsorgeaufwendungen zu unterscheiden: 1. Kranken- und Pflegeversicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) Hierzu zählen die sog. Basisbeiträge – also Leistungen, die dem Umfang nach den gesetzlichen Versicherungen entsprechen. Diese Beiträge für die Basiskranken- und Pflegeversicherung sind in unbegrenzter Höhe als Vorsorgeaufwendungen abziehbar. Es ist auch möglich, Beiträge, die für Folgejahre bestimmt sind, bereits im früheren Jahr der Zahlung steuerlich zu berücksichtigen. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 5 EStG regelt, dass die Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung für künftige Jahre im Zahlungsjahr abziehbar sind, soweit sie das 3-fache der für das Zahlungsjahr gezahlten Beiträge nicht übersteigen. 2. Übrige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG) Hierunter fallen insbesondere Beiträge zur Unfall-, Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung sowie Beiträge für Wahlleistungen der Kranken- und Pflegeversicherung. Anders als die Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind diese nicht unbegrenzt abzugsfähig. Für Arbeitnehmer und Rentner greift eine personenbezogene, jährliche Höchstgrenze i. H. v. 1.900 €, bei Selbständigen, Freiberuflern und Beamten beläuft sich diese Grenze gem. § 10 Abs. 4 S. 1 und 2 EStG auf 2.800 €. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind zwar unbegrenzt abzugsfähig, werden jedoch im Rahmen der vorgenannten Höchstbeträge mitberücksichtigt. In der Praxis führt dies häufig dazu, dass andere Versicherungsbeiträge – etwa zur Haftpflicht- oder Unfallversicherung – sich steuerlich nicht mehr auswirken. Eine Übertragung nicht ausgeschöpfter Beträge in Folgejahre ist nicht möglich; somit verfallen die Versicherungsbeiträge im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG ersatzlos. II. Steueroptimierung Der beschriebene nachteilige Effekt lässt sich vermeiden, indem die Beiträge zur Basisabsicherung für bis zu drei Jahre im Voraus gezahlt werden. Eine solche Vorauszahlung kann sich aus mehreren Gründen vorteilhaft auswirken: 1. Mehr steuerlicher Spielraum in den Folgejahren Da in den Jahren nach der Vorauszahlung keine laufenden Krankenversicherungsbeiträge mehr anfallen, können weitere Versicherungsbeiträge – etwa zur Haftpflicht-, Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung – bis zu den gesetzlichen Höchstgrenzen steuerlich berücksichtigt werden. 2. Steuerentlastung in einkommensstarken Jahren Wer in einem Jahr besonders hohe Einkünfte erzielt (z. B. durch Bonus, Abfindung oder außergewöhnlich gute Geschäftsergebnisse), kann durch die Vorauszahlung den progressiven Steuertarif gezielt abfedern und die Steuerlast wirksam senken. 3. Mögliche Beitragsrabatte Viele Versicherer gewähren zudem Preisnachlässe bei Vorauszahlungen – ein zusätzlicher finanzieller Vorteil neben der Steuerersparnis. III. Für wen sind Vorauszahlungen interessant und wann ist Vorsicht geboten Besonders profitieren können Selbständige, Freiberufler sowie privatversicherte Personen, die ihre Beiträge vollständig selbst tragen, ebenso wie Ehepaare, bei denen beide Partner privat versichert sind. Auch Spitzenverdiener mit hohen Einmalzahlungen oder schwankenden Einkommen können die Vorauszahlung gezielt zur Steueroptimierung nutzen. Weniger sinnvoll ist die Gestaltung für Arbeitnehmer mit Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung, da der Zuschuss bei Wegfall laufender Beiträge steuerpflichtig werden kann. Auch gesetzlich Versicherte, Rentner mit niedrigem Steuersatz oder Steuerpflichtige, die über keine weiteren abzugsfähigen Versicherungen verfügen, profitieren kaum bis gar nicht. Zudem sollte ausreichend Liquidität für die Vorauszahlung mehrerer Jahresbeiträge vorhanden sein. Bitte beachten Sie auch, dass im Todesfall die zu viel geleisteten Beiträge für Folgejahre Erstattungen für die Erben darstellen, die in der Erbschaftsteuererklärung anzugeben sind. IV. Was ist zu beachten - Zahlungsfrist Wichtig ist, dass die Vorauszahlung rechtzeitig im laufenden Jahr erfolgt, um den gewünschten Steuervorteil zu realisieren. Erfolgt die Überweisung innerhalb von zehn Tagen vor oder nach dem Jahreswechsel, gilt sie gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG als im wirtschaftlich zugehörigen Jahr geleistet – eine steuerliche Wirkung im aktuellen Jahr wäre damit ausgeschlossen. Daher sollte die Vorauszahlung vor dem 22. Dezember 2025 vorgenommen werden, um die sogenannte „Zehn-Tage-Regel“ sicher zu umgehen. Empfehlenswert ist es zudem, die geplante Vorauszahlung mit Ihrem Steuerberater abzusprechen, um sie optimal auf Ihre persönliche Situation auszurichten und den größtmöglichen steuerlichen Vorteil zu erzielen. Der ideale Zahlungszeitpunkt hängt von verschiedenen Faktoren - wie z.B. der Entwicklung von Gewinnen, Verlusten oder Sonderzahlungen – ab und sollte daher sorgfältig gewählt werden. V. Fazit Die Vorauszahlung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung stellt eine wirksame und zugleich legale Möglichkeit der Steueroptimierung dar, insbesondere bei schwankenden Einkünften oder hohen Einmalerträgen. Entscheidend ist jedoch, dass sie bewusst geplant und auf die persönlichen Verhältnisse abgestimmt erfolgt. Gerne beraten wir Sie dabei, den für Sie passenden Zeitpunkt und Umfang einer entsprechenden Vorauszahlungsleistung zu bestimmen. Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihren Pelka-Berater oder Frau Melissa Maas bzw. Frau Marie-Christine Schröder wenden oder unser Kontaktformular ausfüllen. Wir freuen uns darauf, Sie unterstützen zu können.

Pelka beriet eine Unternehmerfamilie beim Verkauf ihrer Gesellschaft an eine europäische Konzerngruppe im Wege eines Share-Deals. Gegenstand der Gesellschaft sind der Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen sowie After-Sales-Services eines Premiumherstellers. Der Exit wurde von Pelka sowohl rechtlich als auch steuerlich begleitet, indem u.a. bei der Wertfindung beraten und die notwendigen Verträge verhandelt und rechtlich sowie steuerlich gestaltet wurden. Zugleich wurde die Basis für eine zukünftige langfristige Zusammenarbeit der Parteien nach der Veräußerung auf Basis eines Mietverhältnisses geschaffen. Auch dieser Schritt wurde durch Pelka begleitet. Die Beratung durch Pelka ist nicht nur darauf ausgerichtet, die Wünsche der Mandanten auf Basis der gegebenen Interessenlage zu verhandeln, sondern auch zukünftigen Diskussionen und Streitigkeiten möglichst vorzubeugen. Drohende Interessenkonflikte oder Risiken sind frühzeitig zu erkennen und entweder durch eine vertragliche Regelung oder durch eine praktische Lösung zu entschärfen. Gingen einer Transaktion zudem Umstrukturierungen und Vermögensübertragungen voraus, sind etwaige steuerliche Wirkungen eines Unternehmensverkaufs zu beleuchten und in die Ausgestaltung des Exits einzubeziehen. Um die mit einem Exit verbundenen Chancen und Risiken zu kennen, empfiehlt es sich daher, frühzeitig Berater einzubeziehen. Das Mandat wurde vorwiegend betreut von den Partnern Dr. Marc von Kopp (M&A, Corporate), Dr. Fabian Riegler (Tax und Financial) und Rechtsanwalt Fabian Lünsmann (Real Estate).

I. Einführung Nichtabziehbare Betriebsausgaben im Konzern? Warum grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen zunehmend in den Fokus geraten. Stellen Sie sich vor, ein deutsches Tochterunternehmen leiht sich innerhalb eines internationalen Konzerns 10 Millionen Euro von seiner französischen Muttergesellschaft. Für das Darlehen zahlt es 10 % Zinsen pro Jahr. Auf den ersten Blick scheint der Fall einfach: Zinsen sind steuerlich Betriebsausgaben und mindern den Gewinn – und damit die Steuerlast – des deutschen Unternehmens. Doch hier liegt der entscheidende Punkt: Bei Finanzierungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen müssen die Konditionen „fremdüblich“ sein. Das bedeutet, dass der vereinbarte Zinssatz dem entsprechen muss, was auch unabhängige Dritte unter vergleichbaren Umständen vereinbaren würden. Liegt der marktübliche Zins beispielsweise nur bei 5 %, sind steuerlich auch nur diese 5 % als Betriebsausgaben abzugsfähig. Der darüberhinausgehende Teil wird als nichtabziehbare Betriebsausgabe behandelt. Gerade bei internationalen Konzernen prüfen die Finanzverwaltungen zunehmend kritisch, ob über überhöhte Zinsen Gewinne ins Ausland verlagert werden, um dort von niedrigeren Steuersätzen zu profitieren. In der Praxis kommt hinzu, dass es für viele konzerninterne Darlehen keine direkten Marktvergleichswerte gibt. Unternehmen müssen daher auf Schätzmethoden zurückgreifen, um einen angemessenen, fremdüblichen Zinssatz zu bestimmen. Dieser Beitrag beleuchtet die aktuellen Entwicklungen zu konzerninternen Finanzierungen und zeigt ihnen, worauf Unternehmen bei der kommenden Veranlagung besonders achten sollten. II. Ausgewählte Problemfelder von Finanzierungsbeziehungen Grundsätzlich steht es jedem Unternehmen frei, wie es seine Finanzierung gestaltet – also ob es mehr Eigenkapital einsetzt oder Fremdkapital aufnimmt. Diese Gestaltungsfreiheit findet jedoch steuerliche Grenzen. Denn sowohl die Höhe des Fremdkapitals als auch der vereinbarte Zinssatz beeinflussen den steuerlichen Gewinn unmittelbar. Während marktübliche Zinsaufwendungen auf Fremdkapital grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar sind, gilt dies nicht für überhöhte Zinszahlungen. Um Missbrauch zu verhindern, greifen insbesondere drei zentrale Vorschriften: Die verdeckte Gewinnausschüttung nach § 8 Abs. 3 S. 2 KStG: Diese Vorschrift soll verhindern, dass ein Unternehmen seinem Gesellschafter oder einer dem Gesellschafter nahestehenden Person nicht fremdübliche Vorteile gewährt – etwa in Form überhöhter Zinsen auf ein Darlehen. Solche Zahlungen werden als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt und mindern den Gewinn steuerlich nicht. Die Berichtigung der Einkünfte nach § 1 AStG: Bei grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehungen innerhalb eines Konzerns kann auch § 1 AStG Bedeutung erlangen. Danach müssen sämtliche Preise und Konditionen – einschließlich der Zinssätze – dem sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, also so gestaltet sein, wie sie unabhängige Dritte vereinbaren würden. Die Berichtigung der Einkünfte nach § 4h EstG: Darüber kann die sog. Zinsschranke die Abziehbarkeit von Zinsaufwendungen begrenzen, wenn diese einen bestimmten Betrag erreichen. Damit soll eine übermäßige Fremdfinanzierung zur Gewinnminderung verhindert werden. Ausnahmen, die einen uneingeschränkten Abzug ermöglichen, sieht das Gesetz aber vor. Im Zuge des Wachstumschancengesetzes vom 27. März 2024 hat der Gesetzgeber neue Regelungen eingeführt und die Anforderungen an konzerninterne Finanzierungen im § 1 AStG ausdrücklich festgeschrieben. Diese Änderungen haben die Unsicherheit in der Praxis zunächst erhöht – insbesondere hinsichtlich der Frage, welche Methoden zur Ermittlung fremdüblicher Zinsen künftig zulässig sind. Als Reaktion auf diese Kritik hat die Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben vom 12. Dezember 2024 Stellung bezogen und ihre Verwaltungsgrundsätze angepasst. Dennoch bleiben in der Praxis zahlreiche Detailfragen offen, insbesondere zur Abgrenzung zwischen Finanzierungsbeziehungen und sonstigen Finanzierungsdienstleistungen sowie zur Anwendung der neuen Regelungen ab dem Veranlagungszeitraum 2025. III. Bedeutung der Erweiterung 1. Anerkennung von Zinsaufwendungen dem Grunde nach Unklar war bislang, unter welchen Voraussetzungen konzerninterne Finanzierungen steuerlich überhaupt als Fremdkapital anerkannt werden. Hier schafft der neu eingefügte § 1 Abs. 3d AStG nun spezifische Vorgaben. Eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung des Fremdkapitals ist, dass das Darlehen eine zeitlich begrenzte Kapitalüberlassung darstellt, die nach objektiver Würdigung zurückgeführt werden kann. Es muss also eine ernsthafte Rückzahlungsverpflichtung bestehen. Dabei kommt es maßgeblich auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der darlehensnehmenden Gesellschaft an – insbesondere darauf, ob ausreichend Vermögenswerte oder Zahlungsflüsse vorhanden sind, um den künftigen Kapitaldienst leisten zu können. Auch mit dem Darlehen angeschaffte Vermögensgegenstände können dabei berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist eine vollständige Tilgung während der Laufzeit eines Darlehens nicht zwingend erforderlich. Die Finanzverwaltung erkennt ausdrücklich an, dass Anschlussfinanzierungen marktüblich sind und den wirtschaftlichen Realitäten entsprechen. Entscheidend ist jedoch, dass die Finanzierung wirtschaftlich erforderlich ist und einem unternehmerischen Zweck dient. Fremdkapital sollte nur aufgenommen werden, wenn eine realistische Renditeerwartung besteht. Auch Einlagen in konzerninterne Cash Pools können steuerlich anerkannt werden, sofern eine nachvollziehbare Finanzierungsstrategie dokumentiert ist – etwa im Zusammenhang mit geplanten Akquisitionen, zur Sicherstellung der Liquidität oder zur Vermeidung steuerlicher Nachteile. Die Anerkennung von Zinsaufwendungen erfordert nach den neuen Regelungen eine umfassende und substanzielle Dokumentation. Der Steuerpflichtige muss dabei nachweisen, ob und in welcher Weise der Kapitaldienst erbracht werden kann, dass dieser wie vereinbart geleistet wird und welcher konkrete Zweck mit dem Darlehen verfolgt sowie wie das Kapital tatsächlich verwendet wird. Kann der Steuerpflichtige diese Punkte nicht nachvollziehbar belegen, wird die Finanzierung insoweit steuerlich rückgängig gemacht, als sie nicht unter fremdüblichen Bedingungen erfolgt ist. In der Folge werden die gezahlten Zinsen steuerlich nicht anerkannt, was entsprechende steuerliche Mehrbelastungen nach sich zieht. 2. Zinssatzbestimmung Ein zentraler Punkt der neuen Verwaltungsgrundsätze betrifft die Bestimmung des Zinssatzes für konzerninterne Finanzierungen. Bislang bevorzugte die Finanzverwaltung zur Ermittlung des fremdüblichen Zinssatzes häufig die Kostenaufschlagsmethode. Bei Anwendung dieser Methode wird der fremdübliche Preis anhand der entstandenen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags ermittelt. In ihren neuen Grundsätzen folgt die Finanzverwaltung nunmehr der Rechtsprechung, wonach die Preisvergleichsmethode in vielen Fällen die zutreffendere Grundlage für die Zinsermittlung darstellt. Dies eröffnet den betroffenen Unternehmen zwar mehr Flexibilität, erfordert jedoch zugleich den Zugriff auf Vergleichspreisdatenbanken oder interne Vergleichswerte, um belastbare Marktvergleiche nachweisen zu können. Im Ergebnis müssen Unternehmen nun noch präziser dokumentieren, welche Methode zur Bestimmung des Zinssatzes angewendet wurde, welche Datenquellen der Analyse zugrunde liegen und wie diese die Fremdüblichkeit des gewählten Zinssatzes belegen. Insbesondere in Fällen, in denen geeignete Marktvergleichsdaten fehlen, steigt der Aufwand für Schätzungen und Dokumentation erheblich. 3. Bestandschutz Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich nicht für Darlehen, die bereits vor dem 1. Januar 2024 zivilrechtlich vereinbart wurden, deren tatsächliche Durchführung ebenfalls vor diesem Stichtag begonnen hat und die nicht über das Jahr 2024 hinaus fortgeführt werden. Alle länger laufenden Darlehen, die über 2024 hinaus bestehen, werden jedoch ab 2025 von den neuen Vorschriften erfasst. Ein Bestandsschutz besteht somit nicht. Auch dies trägt zur Komplexität bei, da Unternehmen bestehende Finanzierungen prüfen müssen, um festzustellen, ob und ab wann sie unter die neuen Regelungen fallen. Damit steigt der Anpassungsdruck, insbesondere für konzerninterne Finanzierungen, die ursprünglich auf eine längere Laufzeit ausgelegt waren. IV. Fazit und Ausblick Die neuen Verwaltungsgrundsätze zu den §§ 1 Abs. 3d und 3e AStG bestätigen viele der bereits zuvor geäußerten Bedenken hinsichtlich einer steigenden steuerlichen Komplexität bei konzerninternen Finanzierungen. Gleichzeitig zeigen sie, dass die Finanzverwaltung bemüht ist, an bewährten Grundsätzen festzuhalten und die neuen Vorschriften im Einklang mit den OECD-Leitlinien auszulegen. Für die Praxis ergeben sich daraus jedoch erhebliche Herausforderungen. Unternehmen müssen nicht nur ihre konzerninternen Finanzierungen kritisch prüfen, sondern auch deutlich umfangreichere Dokumentationspflichten erfüllen. Insbesondere das konzerninterne Cash Pooling steht auf dem Prüfstand. Zwar lässt die Finanzverwaltung Spielräume zu, doch müssen Unternehmen künftig noch detaillierter belegen, welchem Zweck die geparkten Mittel dienen und wie lange sie dort verbleiben sollen. Positiv hervorzuheben ist zwar, dass die ausdrückliche Anerkennung der Preisvergleichsmethode bei der Zinssatzbestimmung mehr Rechtssicherheit schafft. Allerdings gibt es keinen echten Bestandsschutz für bestehende Finanzierungen. Auch laufende Darlehen, die über 2024 hinaus bestehen, werden künftig an den neuen Vorschriften gemessen. Unternehmen sollten deshalb frühzeitig ihre Finanzierungsstrukturen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Besonders wichtig ist dabei, dass die Beweislast regelmäßig beim Steuerpflichtigen liegt. Die gesetzliche Verlagerung der Nachweispflicht und die Pflicht zur Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation innerhalb von 30 Tagen nach Prüfungsanordnung erhöhen den Druck auf eine proaktive und rechtssichere Vorbereitung. Insgesamt schaffen die neuen Regelungen mehr Klarheit – doch bleiben viele praktische Fragen offen. Unternehmen sind daher gut beraten, frühzeitig eine individuelle Dokumentationsstrategie zu entwickeln, um späteren Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung vorzubeugen. Sollten Sie zu den Chancen und Risiken von Fremdfinanzierungsbeziehungen Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Füllen Sie hierzu gerne das Kontaktformular aus.

Steigende Energiekosten, volatile Märkte und eine hartnäckige Inflation machen es derzeit kaum möglich, langfristig mit stabilen Mieteinnahmen oder -kosten zu planen. Für Vermieter wie Mieter wird daher immer wichtiger, schon im Vertrag festzulegen, wie sich die Miete künftig verändern darf oder soll – also wie der Vertrag auf die Realität reagiert. Das Gewerbemietrecht lässt hier deutlich mehr Gestaltungsfreiheit als das Wohnraummietrecht. Ob Index-, Staffel- oder Umsatzmiete: Jede Form der automatischen Mietanpassung kann sinnvoll sein – wenn sie klar, transparent und rechtssicher vereinbart ist. Der folgende Überblick zeigt, welche Modelle in der Praxis funktionieren, worauf Sie achten sollten und warum eine saubere Formulierung entscheidend ist. I. Warum Mietanpassungen heute unverzichtbar sind Im Gegensatz zum Wohnraummietrecht gibt es im Gewerbemietrecht keine gesetzlichen Regelungen zur Mieterhöhung. Was nicht im Vertrag steht, gilt nicht. Fehlt also eine Anpassungsklausel, bleibt die Miete über die gesamte Laufzeit unverändert – selbst wenn sich Markt oder Inflation massiv verändern. Das Risiko der Geldentwertung trägt allein der Vermieter. Wer Gewerberaum langfristig vermietet, sollte deshalb bereits bei Vertragsschluss festlegen, nach welchen Regeln sich die Miete im Laufe der Jahre verändern kann. Dabei geht es nicht nur um Fairness, sondern auch um die wirtschaftliche Planbarkeit beider Seiten. II. Die gängigen Modelle der Mietanpassung 1. Indexmiete – Anpassung an die Inflation Die Indexmiete koppelt die Miethöhe an den Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamts. Steigt der Index, darf auch die Miete steigen – sinkt er, kann sie entsprechend fallen. Diese Form der Wertsicherung hält den wirtschaftlichen Wert der Miete über Jahre stabil und schützt den Vermieter vor einer schleichenden Entwertung. Zulässig ist sie nach dem Preisklauselgesetz (PrKG) nur, wenn die Anpassung in beide Richtungen wirkt und sich auf einen amtlichen, objektiven und allgemein zugänglichen Index bezieht. Außerdem muss die Berechnungsformel klar, nachvollziehbar und frei von Ermessen sein. Ein weiterer, oft übersehener Aspekt betrifft die gesetzliche Mindestbindung des Vermieters: Nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 PrKG darf eine Indexklausel nur dann wirksam vereinbart werden, wenn sich der Vermieter für mindestens zehn Jahre an den Vertrag bindet. Damit soll verhindert werden, dass der Vermieter die Indexklausel nur kurzfristig zu seinen Gunsten nutzt und sich bei ungünstiger Indexentwicklung durch Kündigung entzieht. Wird eine Indexklausel ohne die erforderliche Mindestbindung vereinbart, ist sie nicht nichtig, sondern bis zur Feststellung ihrer Unwirksamkeit schwebend wirksam. Die Rechtsfolgen treten dann erst ex-nunc, also ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Unwirksamkeit ein. Frühere Mietanpassungen bleiben bis dahin wirksam, fällig und geschuldet. Das bedeutet: Bis zur Feststellung der Unwirksamkeit gilt der Vertrag grundsätzlich fort und wird nach den vereinbarten Bestimmungen vollzogen; ab dem Zeitpunkt der Feststellung darf die unwirksame Indexvereinbarung jedoch nicht mehr angewendet werden. Die aufgrund der unwirksamen Klausel überhöhte Miete ist dann für die Zukunft auf das rechtlich zulässige Maß herabzusetzen. Vor diesem Hintergrund betont die jüngste Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urteil vom 5. Juni 2025 – 10 U 146/24), wie wichtig eine transparente und regelkonforme Ausgestaltung solcher Indexvereinbarungen ist. Das Gericht erklärte zur Überraschung vieler Beobachter eine Wertsicherungsklausel für AGB-rechtlich unwirksam, weil sie weder eine Einsatzschwelle noch einen festen Anpassungsturnus vorsah und die konkrete Berechnungsmethode unklar blieb. Nach Auffassung des Gerichts verstieß die Klausel sowohl gegen das Transparenzgebot als auch gegen das AGB-rechtliche Verbot unangemessener Benachteiligung (§ 307 BGB). Die Folge: Die Klausel war von Anfang an unwirksam, und der Vermieter musste die überhöhten Mieten zurückzahlen. Dies ist überraschend, wenn man die bis dahin verbreitete Auffassung bedenkt, dass das AGB-Recht neben der spezialgesetzlichen Materie des Preisklauselgesetzes keine Anwendung findet bzw. die auf die Zukunft gerichtete Unwirksamkeitsregelung des § 8 PrKG Vorrang hat. 2. Staffelmiete – klare Zahlen, keine Überraschungen Die Staffelmiete sieht fest vereinbarte Mieterhöhungen zu bestimmten Zeitpunkten vor – etwa jährlich um einen festen Betrag oder Prozentsatz. Sie ist einfach, planbar und verwaltungsarm. Beide Seiten wissen genau, wann welche Miete gilt. Ihr Nachteil: Sie reagiert nicht auf Inflation oder Preisentwicklung. Bei hoher Geldentwertung verliert die Miete real an Wert, bei Preisrückgang bleibt sie unverändert hoch. Daher eignet sich die Staffelmiete vor allem für kurz- bis mittelfristige Verträge oder Einstiegsphasen – etwa, wenn einem neuen Mieter zu Beginn eine reduzierte Miete gewährt wird, die sich später an das Marktniveau annähert. 3. Umsatzmiete – flexibel und erfolgsabhängig Vor allem im Einzelhandel und in der Gastronomie kommt die Umsatzmiete zum Einsatz. Sie passt die Mietbelastung an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Mieters an: Je besser das Geschäft läuft, desto höher die Miete – und umgekehrt. In der Regel wird eine Grundmiete mit umsatzabhängigem Zuschlag vereinbart, etwa: „5 % des Nettojahresumsatzes, mindestens EUR 5.000,00 im Monat.“ Wichtig sind hier klar definierte Umsatzbegriffe (z.B. unter Einbeziehung des Onlineabsatzes oder Gutscheinverkaufs) sowie Einsichts- und Prüfungsrechte des Vermieters in die bestenfalls testierten Umsatzmeldungen des Mieters. Ohne Mindestmiete kann die Vereinbarung einer Umsatzmiete unwirksam sein, weil die Gegenleistung nicht hinreichend bestimmbar ist. Für den Vermieter birgt die Umsatzmiete zudem das Risiko schwankender Einnahmen – sie lohnt sich daher nur in Branchen mit stabilen oder wachsenden Umsätzen. Eine Seltenheit in Zeiten von Onlinehandel und wackliger Konjektur in Folge der weltweiten Zollpolitik. III. Kombinationen mit Augenmaß In der Praxis finden sich zunehmend Kombinationsmodelle – etwa eine Staffelphase in den ersten Jahren, gefolgt von einer Indexierung ab Erreichen des Marktniveaus. So kann der Mieter sich in der Anlaufphase seines Geschäfts etablieren, während der Vermieter langfristig eine inflationsgeschützte Miete erzielt. Vorsicht ist jedoch bei gleichzeitiger Anwendung von Staffel- und Indexmiete geboten. Beide Modelle verfolgen denselben Zweck – den Schutz vor Geldentwertung. Ihre parallele Nutzung würde nach Ansicht des Verfassers diesen Mechanismus doppeln und widerspräche dem Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung. Zudem verlangt das Preisklauselgesetz, dass Indexklauseln auch Mietsenkungen zulassen müssen – was bei gleichzeitig steigender Staffel faktisch ausgeschlossen wäre. Solche Konstruktionen sind daher rechtlich riskant und sollten vermieden werden. IV. Wirtschaftliche und steuerliche Auswirkungen Mietanpassungsklauseln beeinflussen nicht nur die laufenden Einnahmen, sondern auch die Immobilienbewertung nach der ImmoWertV. Da der Ertragswert auf der nachhaltig erzielbaren Miete basiert, verändert sich durch Index-, Staffel- oder Umsatzklauseln die Kapitalisierung und damit der Verkehrswert. Zudem können Mietänderungen umsatzsteuerliche Folgen haben: Wird die Miete nachträglich angepasst, kann dies rückwirkende Korrekturen nach § 17 UStG auslösen – insbesondere, wenn sich die Bemessungsgrundlage ändert oder eine Mietminderung vereinbart wird. V. Fazit: Flexibilität braucht klare Regeln Automatische Mietanpassungen sind ein wirksames Instrument, um wirtschaftliche Entwicklungen vertraglich abzusichern – vorausgesetzt, sie sind transparent, nachvollziehbar und rechtssicher formuliert. Vermieter profitieren von stabilen Erträgen, Mieter von planbaren Konditionen. Doch fehlerhafte oder zu unklare Klauseln können teuer werden: Wird eine Anpassungsregelung von den Gerichten für unwirksam erklärt, gilt die Miete meist zulasten des Vermieters als festgeschrieben – oft für die gesamte Vertragslaufzeit. Deshalb lohnt sich eine individuelle Prüfung bestehender Mietverträge und eine rechtssichere Neugestaltung bei Vertragsabschlüssen. Denn klar geregelte Anpassungsmechanismen sind nicht nur juristische Feinheiten, sondern entscheidende Bausteine wirtschaftlich tragfähiger Mietverhältnisse. Praxistipp : Prüfen Sie ältere Gewerbemietverträge – insbesondere solche mit Indexklauseln ohne Einsatzschwelle oder Berechnungsformel. Die aktuelle Rechtsprechung setzt hier deutlich strengere Maßstäbe als bislang. Findige Mieteranwälte dürften hier bald auf den Geschmack der neuen Möglichkeiten des AGB-Rechts kommen. Wir begleiten Sie in allen Fragen des gewerblichen Miet- und Immobilienrechts – von der rechtlichen Prüfung bestehender Verträge über die Gestaltung und Verhandlung neuer Miet- und Pachtverhältnisse bis hin zur strategischen Beratung bei komplexen Immobilienprojekten. Für eine individuelle Beratung oder eine erste Einschätzung Ihres Anliegens wenden Sie sich gerne direkt an Rechtsanwalt Fabian Lünsmann, LL.M. (UCT), an Ihren Pelka-Berater oder nutzen Sie bequem unser Kontaktformular .

I. Überblick Durch das Ableben des Erblassers entsteht für dessen Erben bei der Abwicklung des Erbfalls nicht nur ein hoher organisatorischer Aufwand. Neben einer potenziellen Erbschafsteuerbelastung ergeben sich oftmals auch erhebliche weitere Kosten für Notare, Gerichte und andere Institutionen. Besonders die Kosten für die Erteilung eines Erbscheins fallen dabei häufig ins Gewicht, obwohl sich diese in vielen Fällen vermeiden oder zumindest reduzieren lassen. In Bezug auf den Erbschein lohnt es sich daher, vor dessen Beantragung zu prüfen, ob er überhaupt notwendig ist oder sich die Kosten der Ausstellung durch eine Beschränkung zumindest verringern lassen. II. Rechtliche Möglichkeiten zur Reduktion der Kosten eines Erbscheinverfahrens 1. Notwendigkeit eines Erbscheins Gegenüber öffentlichen Einrichtungen wie dem Handelsregister oder dem Grundbuchamt können die Erben an Stelle des Erblassers als dessen Gesamtrechtsnachfolger handeln, wenn ein Nachweis der Erbenstellung vorliegt. Dieser Nachweis kann in den Fällen, in denen kein notarielles Testament und kein Erbvertrag existieren, grundsätzlich nur durch einen Erbschein erfolgen. Insoweit kann bereits die Existenz eines notariellen Testaments oder eines Erbvertrags die Notwendigkeit eines Erbscheins entfallen lassen. Der Nachweis der Erbenstellung durch notarielles Testament erfordert zusätzlich allerdings die Vorlage des Eröffnungsprotokolls des Nachlassgerichts, das den Vorgang der erfolgten Testamentseröffnung dokumentiert. Auch Banken und Versicherungen fordern in aller Regel einen Nachweis der Erbenstellung. Gerade bei Banken gestaltete sich dieser Nachweis in der Vergangenheit aber nicht immer einfach. Bereits vor längerem kippte der BGH mit Urteil vom 08.10.2013 – XI ZR 401/12 die bis dahin vielfach in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken und Sparkassen enthaltene Regelung, mit der sich die Institute pauschal das Recht vorbehielten, von (Mit-)Erben nach ihrem freien Ermessen die Vorlage eines Erbscheins zu verlangen. Danach fand sich in den Bank-AGB eine Regelung, wonach ein Erbnachweis „in geeigneter Weise“ zu erbringen ist. Mit Urteil vom 05.04.2016 – XI ZR 440/15 hatte der Bundesgerichtshof erstmals entschieden, dass der Erbe sein Erbrecht gegenüber der Bank auch durch ein eröffnetes privatschriftliches Testament belegen kann, wenn dieses die Erbfolge eindeutig ausweist. Aufgrund dieser Rechtsprechung kam es erneut zu einer Änderung der Banken-AGB, die nunmehr den Nachweis durch Testament oder Erbvertrag, ggf. i.V.m. dem Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts, ausdrücklich zulassen. Auch im Hinblick auf die Nachlassabwicklung mit Banken wird ein Erbschein daher nicht mehr zwangsläufig benötigt. 2. (Vorsorge-)Vollmacht als Alternative zum Erbschein Existiert kein notarielles Testament und kein Erbvertrag und gehören zum Vermögen des Erblassers weder Gesellschaftsbeteiligungen noch Grundstücke, so reduziert sich die Rolle des Erbscheins häufig auf den Nachweis der Erbenstellung gegenüber den kontoführenden Banken. Hintergrund des Nachweiserfordernisses ist das Schadensrisiko der Bank, die bei einem unberechtigten Kontenzugriff ggf. mehrfach in Anspruch genommen werden kann. Eines Nachweises der Erbenstellung bedarf es allerdings in solchen Fällen nicht, in denen der Erbe durch den Erblasser nachweislich zum Kontenzugriff – auch über den Tod des Vollmachtgebers hinaus – bevollmächtigt ist. Eine derartige Bevollmächtigung kann insbesondere durch eine (Vorsorge-)Vollmacht des Erblassers erfolgen, die zu Lebzeiten ausgestellt und die explizit über seinen Tod hinaus gelten soll (sog. transmortale Vollmacht). Ist hingegen nicht gewünscht, dass der Erbe bereits zu Lebzeiten des Erblassers über dessen Konten verfügen können soll, kann alternativ auch eine sogenannte postmortale Vollmacht erteilt werden. Im Gegensatz zur transmortalen Vollmacht wird die postmortale Vollmacht zwar zu Lebzeiten des Erblassers erteilt, sie tritt aber erst nach dem Tod des Erblassers in Kraft. In beiden Fällen wird der Bevollmächtigte in die Lage versetzt, das Bankguthaben nach dem Tod des Erblassers einzuziehen, ohne auf die Erteilung eines Erbscheins warten zu müssen. Befinden sich im Nachlass weder Grundstücke noch Gesellschaftsbeteiligungen können durch eine solche Vollmacht die Notwendigkeit eines Erbscheins und damit auch die entsprechenden Kosten für ein Erbscheinverfahren sogar gänzlich entfallen. Um Nachweisproblemen aus dem Wege zu gehen, empfiehlt sich für den Vollmachtgeber in jedem Fall die Vorsorge-Vollmacht notariell beurkundet zu erteilen, wenigstens aber sie notariell beglaubigt zu unterschreiben. Um im Verhältnis zu den kontoführenden Banken auf der sicheren Seite zu sein, kann der Erblasser zusätzlich eine trans- oder postmortale Bankvollmacht auf den Formularen des jeweiligen Kreditinstituts erteilen, deren Anerkennung die Bank schwerlich in Frage stellen kann. 3. Potenzielle Beschränkung eines Erbscheins Die Gebühren für einen Erbschein bemessen sich nach dem Wert des Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalls, also grundsätzlich nach dem Wert des gesamten Nachlasses. Ist ein Erbschein zwingend erforderlich, weil ein Erbnachweis benötigt wird, aber kein notarielles Testament oder Ähnliches existiert, können sich je nach Umfang des Nachlasses hohe Kosten für die Erbscheinerteilung ergeben. Wird nur für einen Teil des Vermögens ein Nachweis benötigt, stellt sich häufig die Frage, ob der Erbschein auch nur für den Teil des Vermögens, für das der Erbnachweis erforderlich ist, ausgestellt werden und hierdurch ein niedrigerer Gegenstandswert (und damit niedrigere Gebühren) erreicht werden kann. Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH ist eine Beschränkung des Erbscheins allerdings nur in denjenigen Fällen möglich, in denen dies ausdrücklich durch das Gesetz gestattet wird. Einen solchen Fall stellt der sogenannte „gegenständlich beschränkte Erbschein“ nach § 352c FamFG dar. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Art des Erbscheins, der beantragt werden kann, wenn sich das Nachlassvermögen zu einem Teil im deutschen Inland und zu einem anderen Teil im Ausland befindet. Der Erbschein kann dann auf den inländischen Vermögensteil beschränkt werden, was mit einer Reduzierung des Gegenstandswerts und damit auch der Kosten für den Erbschein einhergeht. Die Ausstellung eines gegenständlich beschränkten Erbscheins erfolgt allerdings nicht von Amts wegen und muss daher im Rahmen des Erbscheinverfahrens ausdrücklich beantragt werden. III. Zusammenfassung Hinsichtlich des Erfordernisses eines Erbscheins kann in einigen Fällen der Nachlassabwicklung eine erhebliche Kostenersparnis herbeigeführt werden. Existiert ein notarielles Testament oder ein Erbvertrag ist ein Erbschein – auch gegenüber Banken – grundsätzlich nicht erforderlich. Auf die Beantragung eines Erbscheins kann in diesen Fällen daher grundsätzlich verzichtet werden. Ist ein Erbnachweis aufgrund der Vermögenslage des Erblassers nur gegenüber der Bank erforderlich, kann durch Ausstellung einer trans- oder postmortalen Vollmacht zu Lebzeiten des Erblassers die Erteilung eines Erbscheins ebenfalls vermieden werden. Ist ein Erbschein hingegen zwingend erforderlich, lässt sich eine Kostenersparnis ggf. durch gegenständliche Beschränkung nur erreichen, wenn sich ein Teil des Nachlassvermögens im Ausland befindet. Sollten Sie zu den Möglichkeiten der Kostenersparnis nach einem Erbfall Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Nehmen Sie hierzu Kontakt zu unserem Kollegen Stephan Hettler auf oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
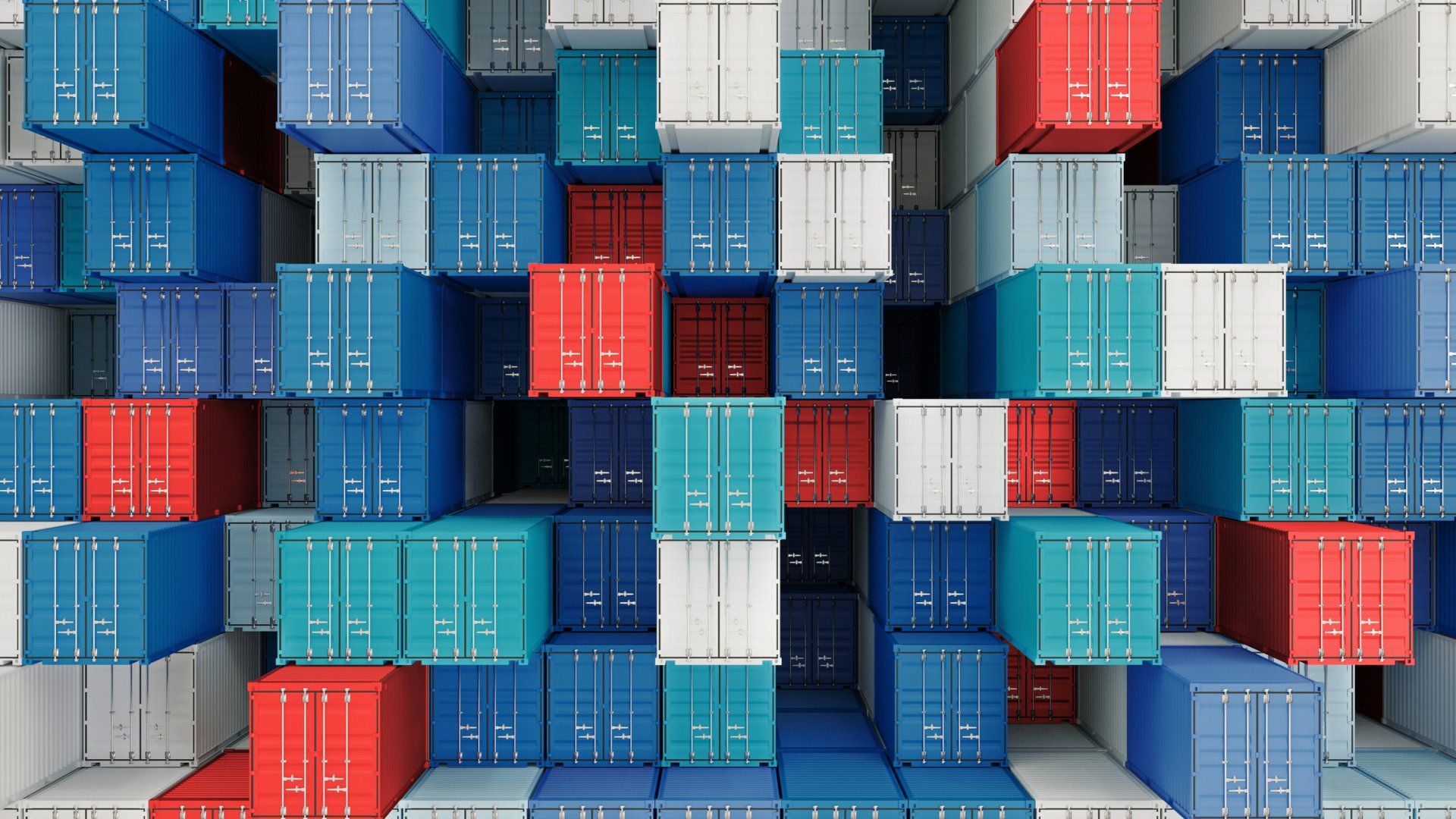
I. Einleitung Für Unternehmen, die im europäischen Binnenmarkt in Bezug auf den Warenhandel grenzüberschreitend tätig sind, sind aus umsatzsteuerlicher Sicht sog. „Innergemeinschaftliche Lieferungen“, „Reihengeschäfte“ oder auch das „Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft“ zentrale Themen in deren Alltagsgeschäft. Die korrekte umsatzsteuerliche Handhabung stellt die Unternehmen aber regelmäßig vor erhebliche praktische Herausforderungen. Innergemeinschaftliche Lieferungen sind nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG in Verbindung mit § 6a UStG unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei, erfordern hierfür jedoch eine präzise Einhaltung der materiell-rechtlichen und formellen Anforderungen, unter anderem im Hinblick auf die Verwendung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die korrekte Abgabe der Zusammenfassenden Meldung. Fehler in der Abwicklung, wie unvollständige Nachweise oder fehlerhafte Meldungen, werden häufig erst im Rahmen von Betriebsprüfungen entdeckt und können zu erheblichen Steuernachzahlungen führen. Die Komplexität steigt weiter, wenn innergemeinschaftliche Lieferungen im Rahmen von Reihengeschäften erfolgen. Bei einem Reihengeschäft liegen mehrere Lieferungen zwischen verschiedenen Unternehmern vor, wobei die tatsächliche Warenbewegung direkt vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer erfolgt. Hierbei kommt es auf die umsatzsteuerliche Ortsbestimmung der einzelnen Lieferungen an. Die korrekte Zuordnung der sog. bewegten Lieferung ist letztlich entscheidend für die Steuerbefreiung. Dieser Beitrag befasst sich im Speziellen mit einer Sonderform des (grenzüberschreitenden) Reihengeschäfts, dem sog. Innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. II. Funktionsweise und Zweck des Innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts 1. Funktionsweise Beim innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft handelt es sich um eine besondere Form des Reihengeschäfts. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft im Sinne von § 25b Abs. 1 UStG gegeben ist: Es muss eine mindestens dreigliedrige Umsatzkette mit Unternehmern, bestehend aus dem ersten Lieferer A, dem Zwischenhändler B und dem Abnehmer C, vorliegen und die Ware direkt vom Lieferer A zum Abnehmer C gelangen. Die Warenbewegung muss dabei zwischen zwei verschiedenen Mitgliedstaaten stattfinden und die Verantwortung für den Transport entweder beim ersten Lieferer A oder beim Zwischenhändler B liegen. Bei der Abwicklung müssen die beteiligten Unternehmer Umsatzsteuer-Identifikationsnummern aus verschiedenen Mitgliedstaaten verwenden. Liegt ein Dreiecksgeschäft in diesem Sinne vor, gibt es weitere Bedingungen, unter denen der Zwischenhändler B die nach der Gegenleistung zu bemessende Umsatzsteuer für den Umsatz mit Lieferort im Bestimmungsland auf den Abnehmer C übertragen kann. Bevor der Zwischenhändler B die Lieferung tätigt, muss er den Liefergegenstand vom ersten Lieferer A im Rahmen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs erhalten haben. Für den Zwischenhändler B greift die Erleichterung durch die Übertragung der Steuerschuld auf den Abnehmer C aber nur dann, wenn der Zwischenhändler B im Bestimmungsland weder ansässig ist, noch eine von dort vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwendet. Die Verwendung einer vom Bestimmungsland vergebenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist für die Anwendung der Steuerschuldumkehr hingegen dem Abnehmer C vorbehalten und zwingende Voraussetzung. 2. Zweck Letztlich bringt die Regelung zum innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft hauptsächlich Erleichterungen für den Zwischenhändler B in einem innergemeinschaftlichen Reihengeschäft, vor allem im Hinblick auf die Registrierungspflichten im Bestimmungsland der gehandelten Ware. Denn als Abnehmer für den Umsatz des ersten Lieferers A verwirklicht er beim Dreiecksgeschäft zum einen im Bestimmungsland den Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs, zum anderen verschafft er bei seinem Folgeumsatz dem Abnehmer C die Verfügungsmacht erst im Bestimmungsland und löst dort wiederum einen umsatzsteuerbaren Vorgang aus. Beide Tatbestände würden ohne die Vereinfachungsregelung des § 25b UStG die steuerliche Registrierung des Zwischenhändlers B im Bestimmungsland erfordern. Durch die in § 25b Abs. 2 UStG geregelte Rechtsfolge kann der Zwischenhändler B jedoch die Umsatzsteuerschuld aus dem Umsatz an den Abnehmer C im Bestimmungsland auf diesen übertragen. Diesbezüglich entfällt eine Registrierungspflicht. Gleichzeitig ist mit dem Übergang der Steuerschuld auf den Abnehmer C die Rechtsfolge verbunden, dass in diesem Fall der innergemeinschaftliche Erwerb des Zwischenhändlers B zudem als besteuert fingiert wird. III. Praktische Hinweise und aktuelle Rechtsprechung 1. Beispiel Anhand eines einfachen Beispiels sollen nochmal die Funktionsweise und Vereinfachungen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts verdeutlicht werden: Abnehmer C aus Polen bestellt beim Zwischenhändler B in Deutschland eine Maschine. B bestellt selbst beim Lieferer A aus Frankreich. A befördert die Maschine mit eigenem Lkw direkt aus Frankreich nach Polen und übergibt sie dort C. Alle drei Unternehmer verwenden jeweils ihre nationale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Es liegt ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft vor. Der Ort der ersten Lieferung des A, dem als warenbewegter Lieferung die Beförderung zugerechnet wird, befindet sich im Ursprungsland Frankreich und ist nach französischem Recht zu beurteilen (evtl. steuerfrei, A hat ggf. in Frankreich eine Zusammenfassende Meldung abzugeben). Zwischenhändler B muss einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Polen versteuern (und hat dort in gleicher Höhe ggf. den Vorsteuerabzug). Der Lieferort der nachfolgenden Lieferung des B an C befindet sich in Polen, sodass diese Lieferung der polnischen Umsatzsteuer unterliegt. Der deutsche Zwischenhändler B müsste sich eigentlich in Polen umsatzsteuerlich registrieren lassen. Durch die Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte wird die Registrierung in Polen für B vermieden. Denn der im Bestimmungsland Polen ansässige letzte Abnehmer C übernimmt für den deutschen Zwischenhändler B die aus dessen Lieferung resultierende polnische Steuerschuld und C kann die nach § 25b UStG geschuldete Umsatzsteuer selbst als Vorsteuer abziehen, soweit er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Der vom Zwischenhändler B in Polen getätigte innergemeinschaftliche Erwerb gilt als besteuert, also als erledigt. Der deutsche Zwischenhändler B wird letztlich von den Erklärungspflichten im Bestimmungsland Polen befreit. Jedoch muss B in seinem Ansässigkeitsstaat Deutschland seine Lieferung an C gegenüber den deutschen Finanzbehörden wie folgt erklären: In der USt-Voranmeldung bzw. -Jahreserklärung (ohne Umsatzsteuerschuld gem. § 25b UStG) sowie In der Zusammenfassenden Meldung mit Angabe der polnischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers C (dies soll der Kontrolle dienen, ob der Abnehmer C in Polen seinen umsatzsteuerlichen Pflichten nachkommt). Die Vereinfachungsregelung erfordert materiell-rechtlich zwingend, dass der mittlere Unternehmer in seiner Rechnung an den letzten Abnehmer des Dreiecksgeschäfts die Umsatzsteuer nicht gesondert ausweist, auf das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft hinweist (z. B. "Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nach § 25b UStG" oder "Vereinfachungsregelung nach Art. 141 MwStSystRL") den letzten Abnehmer auf die auf ihn überwälzte Steuerschuldnerschaft hinweist, seine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die des letzten Abnehmers im Dreiecksgeschäft angibt. 2. Praxishinweise Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft erfordert also zwingend, dass in der Rechnung des Zwischenhändlers auf die Steuerschuldnerschaft des Erwerbers bzw. Abnehmers hingewiesen wird. Diesbezügliche Abrechnungsfehler sind nicht rückwirkend heilbar. So haben EuGH (EuGH in der Rs. „Luxury Trust Automobil“; Urteil v. 8.12.2022 - C-247/21) und BFH (vgl. BFH, Urt. v. 17.7.24, XI R 35/22) aktuell entschieden. Der in § 14a Abs. 7 UStG geforderte Hinweis auf das Dreiecksgeschäft in der Rechnung des mittleren Unternehmers an seinen Abnehmer ist nach Auffassung des BFH in allen Fällen eine materiell-rechtliche Voraussetzung für die Anwendung des Dreiecksgeschäfts. Fehlen die entsprechenden Hinweise in der Rechnung, können die Vereinfachungsfolgen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts nicht eintreten. Da sich Unternehmen häufig gar nicht bewusst sind, dass sie an einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft beteiligt sind, sollten insbesondere die Buchhaltungsabteilungen darauf sensibilisiert werden, diese zu erkennen. Andererseits sind die Regelungen zum innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft jedoch „nur“ ein Wahlrecht für den mittleren Unternehmer, so dass die Rechtsfolgen nur dann eintreten, wenn der mittlere Unternehmer die Anwendung auch klar und eindeutig beantragt. Sofern Unternehmen die Vereinfachungsregelung bewusst in Anspruch nehmen möchten, sollten sie auf die korrekte Umsetzung der strengen formalen Vorgaben achten, damit die Vereinfachungen auch wirklich eintreten. Dies erfolgt regelmäßig durch die Ausstellung von korrekten Rechnungen sowie der Deklaration in der lokalen Umsatzsteuer-Voranmeldung und in der Zusammenfassenden Meldung. Wird ein Dreiecksgeschäft falsch „umgesetzt“, kann dies für den mittleren Unternehmer zu erheblichem Mehraufwand und Kosten führen. Er muss sich ggf. nachträglich im Bestimmungsmitgliedstaat umsatzsteuerlich erfassen und dort innergemeinschaftliche Erwerbe sowie lokale Lieferungen erklären. Dies kann bei nachträglichem Erkennen zusätzlich zu Nachzahlungen oder gar Strafen führen. Bei der korrekten umsatzsteuerlichen Behandlung von Reihengeschäften im Allgemeinen oder der richtigen umsatzsteuerlichen Handhabung von innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften im Besonderen unterstützen wir Sie gerne. Setzen Sie sich bei Fragen mit Ihrem Pelka-Berater oder Herrn Di Wu in Verbindung oder füllen unser Kontaktformular aus.

Bereits in der Vergangenheit haben wir in unseren Beiträgen (zu Teil III hier ) die steuerlichen und rechtlichen Aspekte rund um Influencer und Content-Creator beleuchtet. Nachdem die Finanzverwaltung einige Jahre den Schwerpunkt augenscheinlich nicht auf diese Steuerpflichtigen legte, ist aktuell eine deutliche Verschärfung seitens der Finanzämter zu beobachten: Von der Einrichtung von Sonder-Influencer-Teams bei den entsprechenden Behörden bis zur Zusammenarbeit mit den einschlägigen Online-Plattformen und der Initiierung neuer Ermittlungsmethoden: die Behörden gehen derzeit mit Nachdruck gegen Steuerhinterziehung im Bereich der Influencer und Content-Creator vor. So werden bereits jetzt Strafverfahren gegen in dieser Branche aktive Personen geführt. Gegenstand der Verfahren sind dabei im Durchschnitt steuerliche Fehlbeträge im hohen fünfstelligen Bereich, in Einzelfällen sogar in Millionenhöhe. I. Die steuerlichen Fallstricke im Überblick Die Wege, als Influencer und Content-Creator Einnahmen zu generieren, sind vielfältig, eine Einordnung daher oftmals unübersichtlich: Vergütungen für Klicks, Einnahmen aus Affiliate-Links oder Werbekooperationen, Abo-Zahlungen, „Trinkgelder“ für persönliche Fotos, Produktplatzierungen, Einnahmen aus der Teilnahme an TV-Formaten oder Preisgelder aus Gaming-Turnieren – und neue Konzepte keimen ständig auf, die laufend einer steuerlichen Einordnung bedürfen. Nicht alle Kreativen sind sich möglicherweise den steuerlichen Pflichten bewusst, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind. Dies führt teilweise zu immensen – teilweise sogar strafrechtlichen – Konsequenzen. Ob einkommen-, gewerbe-, umsatz- oder sogar schenkungsteuerlich – die steuerlichen Fallstricke sind vielschichtig. Mittlerweile dürfte allseits bekannt sein, dass in aller Regel auf die erzielten Einnahmen Einkommen- und Gewerbesteuer zu entrichten ist. Wer in Deutschland seinen Wohnsitz hat oder sich hier gewöhnlich aufhält, ist mit seinen gesamten Einkünften steuerpflichtig. Doch was einkommensteuerpflichtige Einkünfte sind, bedarf oftmals einer Prüfung im Einzelfall. In der Regel wird durch die Tätigkeit als Influencer oder Content-Creator zudem ein Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes begründet. Daraus resultiert sowohl eine Gewerbesteuerpflicht als auch weitere Verpflichtungen wie die Anmeldung bei dem zuständigen Gewerbeamt. Auch umsatzsteuerliche Pflichten sind nicht außer Acht zu lassen. Dabei kann bereits die Nichtangabe von Einkünften oder Umsätzen den Vorwurf der Steuerhinterziehung begründen. Zuletzt gingen zudem immer wieder Schlagzeilen durch die Presse, dass auch Geldgeschenke in Höhe von mehreren zehntausenden oder sogar hunderttausenden Euros keine Seltenheit darstellen. Auch derartige freiwillige Leistungen von Fans oder Kunden ohne entsprechende Gegenleistungen sind nicht steuerfrei, sondern als Schenkungen, sofern sie die Freibetragsgrenze überschreiten, zu versteuern und auch als solche gegenüber den Finanzbehörden anzuzeigen. II. Wegzug ins Ausland Immer mehr Influencer und Content-Creator wollen aufgrund der steuerlichen Belastung Deutschland den Rücken kehren. Doch auch ein Wegzug ins Ausland entbindet nicht automatisch von steuerlichen Pflichten in Deutschland und sollte vorher gut durchdacht und geplant werden. Zum einen ist auch derjenige, der zwar keinen Wohnsitz (mehr) in Deutschland hat, aber hier Einkünfte erzielt, beschränkt auf diese Einkünfte weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Zum anderen greift die deutsche erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wenn zwar der Wohnsitz bzw. der gewöhnliche Aufenthalt ins Ausland verlagert wird, aber wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland behalten werden. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, werden zwar vielfach internationale Abkommen herangezogen, doch gerade bei Zielstaaten mit niedriger oder überhaupt keiner Besteuerung bestehen hier oft Lücken. Eine frühzeitige steuerliche Planung ist daher unerlässlich. Daneben droht durch den Wegzug aus Deutschland zudem eine zwar einmalige, aber hohe Steuerbelastung durch eine sog. Entstrickung von Wirtschaftsgütern. Besonders relevant sind dabei die sog. selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgüter. Darunter können u.a. bestehende Kundenbeziehungen, Social-Media Accounts mit entsprechender Reichweite oder auch Private-Label-Produkte fallen. Durch die Entstrickung wird der in Deutschland entstandene Wertzuwachs dieser Vermögenswerte aufgedeckt und in Deutschland steuerpflichtig. III. Was tun bei Zweifeln, vermutetem Verstoß gegen steuerliche Pflichten oder geplantem Umzug? Sollten Sie befürchten, dass Steuererklärungen unvollständig waren oder Steuern nicht korrekt abgeführt wurden, ist ein schnelles, aber auch wohl überlegtes Handeln entscheidend. Die Möglichkeit einer Selbstanzeige bietet hier einen Weg, bestehende Steuerverstöße strafbefreiend zu bereinigen – vorausgesetzt, sie wird ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Eine fehlerhafte oder unvollständige Selbstanzeige kann die Vorteile zunichte und stattdessen das Finanzamt auf den Verstoß aufmerksam machen. Dies kann erhebliche, insbesondere auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ähnlich verhält es sich bei einem geplanten Umzug ins Ausland. Ein solcher erfordert eine gründliche Planung und möglicherweise Anpassung der Geschäftsstrukturen. Eine vorgelagerte Steuerplanung, vor allem im Hinblick auf immaterielle Werte, ist dabei unumgänglich, um potenzielle Steuerfallen zu vermeiden. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig eine steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. IV. Fazit Die steuerlichen Fallstricke für Influencer und Content-Creator sind vielschichtig. Behördliche Kontrollen der steuerrelevanten Verhältnisse nehmen zudem zu. Eine vorausschauende und fundierte steuerliche Beratung ist unerlässlich, um Fallstricke zu vermeiden und auf der sicheren Seite zu bleiben. Haben Sie Zweifel oder vermuten Sie sogar bereits steuerliche Probleme, so sollten Sie nicht zögern und frühzeitig professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Gerne stehen wir Ihnen mit zur Seite – sowohl bei der präventiven Planung als auch bei der Begleitung von Selbstanzeigen oder sonstigen steuerlichen Fragestellungen rund um Ihre Tätigkeit. Füllen Sie gerne unser Kontaktformular aus.




